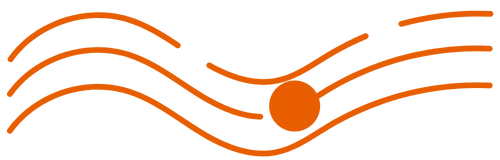Vor ein paar Jahren kaufte ich in der Londoner National Portrait Gallery eine Postkarte, auf deren Vorderseite eine Reihe von Porträts aus dem Fotoarchiv des Museums zu sehen ist. Die Porträts sind rund 120 Jahre alt und das Resultat erkennungsdienstlicher Behandlungen. Sie zeigen Frauen.
Manche mit, manche ohne Hut. Alle machen einen etwas zerrupften und fragwürdigen Eindruck. Die Frauen sind festgenommen und eingesperrt worden, weil sie für ihre Rechte demonstrierten.
Vor 120 Jahren war es ein riskantes Unterfangen, für die eigenen Rechte einzutreten. Frauen kamen ins Gefängnis, weil sie, wie Emily Davison (1878–1913), eine ihrer prominenten Vertreterinnen, versuchten, dem Premierminister eine Petition zu übergeben. Das brachte Davison einen Monat Haft ein, wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“.
Viel öfter und von der Öffentlichkeit unbemerkt, bekamen Frauen eine Diagnose und wurden in die Anstalt gebracht. Kürzlich las ich in einem Kontext, an den ich mich nicht mehr erinnere, den Begriff „Pseudofrau“ als Schimpfwort für Frauen, die sich ihren naturgegebenen Pflichten verweigerten.
Nicht konforme Weiblichkeit als medizinische Diagnose.
Die Pathologisierung des weiblichen Denkens wie des weiblichen Körpers hat eine sehr lange Geschichte. Sie schwingt immer noch mit in unseren Köpfen, wenn wir uns abwertend gegenüber (anderen) Frauen und gegenüber unserem eigenen Körper verhalten.
Donna J. Haraway bemerkt in „Unruhig bleiben“:
„Es ist von Gewicht, welche Geschichten Welten machen und welche Welten Geschichten machen“.
Die Geschichten der westlichen Welt sind patriarchale Geschichten. Die Geschichte der Frauen wurde mit wenigen Ausnahmen von Männer erzählt, die die Frauen systematisch aus den Geschichten herausstrichen. Aus den Musikgeschichten, Kunstgeschichten, Wissenschaftsgeschichten.
Emily Davison studierte Chemie, englische Sprache und Literatur am St Hugh’s College in Oxford, was sie sich nur leisten konnte, weil sie dafür arbeitete. Ihr Studium schloss sie mit Auszeichnung ab. Der akademische Grad, für Frauen nicht vorgesehen, blieb ihr verwehrt.
Sie war radikal und bestimmt eine sehr unbequeme Person, die sich für die Sache der Frauenbewegung selbst verletzte, in den Hungerstreik trat und ihr Leben beendete, indem sie 1913 beim Epson Derby vor das Rennpferd des amtierenden Königs lief. Der Jockey wurde nur leicht verletzt, über die Folgen für das Pferd wird kein Wort verloren und die
Nachwelt streitet sich, ob Davison mit der Aktion für die Einführung des Frauenwahlrechts streiten oder Suizid begehen wollte.
Für mich nimmt sich das nichts: Frauen, die an den äußeren Umständen, die ihnen das Leben ihrer Wahl verwehren und sie rechtlos setzen, verzweifeln, protestieren mit ihrem Selbstmord auf jeden Fall gegen jene Umstände.
Lasst mich meine Stimme erheben – über Jahrtausende eine ungehörte Forderung. Selbst wenn Frauen sprachen, blieben sie stumm.
Joana Mallwitz ist Dirigentin. 2014 trat sie als jüngste Generalmusikdirektorin Europas eine Stelle in Erfurt an. Ab 2018 setzte sie in gleicher Funktion in Nürnberg Zeichen. Auch, weil sie weiterhin sehr jung war, weil sie 2019 zur „Dirigentin des Jahres“ gewählt und weil sie ein Star auf dem männlich dominierten Weltdirigent*innen Parkett wurde. Weil sie ein Kind zur Welt brachte und den fordernden Familienalltag mit ihrem Ehemann, einem international tätigen Tenor, paritätisch meistert, wobei auch andere Familienmitglieder helfend einspringen.
2024 kam der Dokumentarfilm „Momentum“ über Joanna Mallwitz ins Kino. Ich höre sie sagen, sie habe ihr Musikerinnenleben lang versucht, dem Frauenthema auszuweichen. Und werde immer wieder danach gefragt. Sie als Frau, wie ist das so?
Mich hat das nachdenklich gemacht. Tatsächlich war es mir noch gar nicht in den Sinn gekommen, darüber nachzudenken, dass die ständige Aufforderung zur Stellungnahme der Situation der Frau in einem von Männern dominierten Beruf eine Zumutung sein könnte!
Müssen Frauen nicht wild und vehement Lanzen für den Fortschritt der Bewegung brechen, wenn sie schon an prominenter Stelle tätigt sind?
Heute denke ich entschieden: Nein.
Wir können zu der ganzen Mental Load Thematik gleich den Aufwand hinzupacken, der für Frauen entsteht, weil sie sich ständig erklären müssen.
Frauen müssen erklären, dass sie nicht ihre Tage haben, nicht unter den Wechseljahren leiden, sich nicht als permanentes Opfer männlicher Gewalt und Willkür sehen, nicht schlechte Menschen sind, weil sie ihre Kinder in die Ganztagesbetreuung geben.
Frauen müssen erklären, dass sie einfach ihren Job machen, weil sie das, was sie tun, halt am besten können.
Am meisten müssen Frauen sich erklären, wenn sie eine für den Rest der patriarchalen Welt überraschende Bekanntheit erlangt haben.
Solange Frauen in führenden Positionen landauf, landab die Frauenfrage gestellt wird, sind wir Frauen weiterhin schlecht aufgestellt.
Die Kanadierin Donna Strickland, die 2018 als 3. Frau überhaupt den Physiknobelpreis erhielt (nach Marie Curie, 1903, und Maria Goeppert-Mayer, 1963), sagte in einem Interview (24. Oktober 2024, DIE ZEIT Nr. 45):
„Mit Männern wollen alle über ihre Wissenschaft sprechen. Wir bekommen zusätzlich diese ganzen Frauen-Fragen.“
Sie erzählt auch, dass ihre wissenschaftliche Karriere nie aufgehalten wurde, weil sie eine Frau war. Sie weiß, dass andere Frauen andere Geschichten erlebt haben.
„Ich sage nur: Das war nicht meine Geschichte.“
Allerdings, so berichtet Strickland weiter, wenn sie auf ihre eigenen Erfahrungen hinweise, sei die Reaktion vieler:
„Ja, das sagt sie zwar, aber in Wirklichkeit war es ganz anders.“
Frauen müssen sich auch dazu erklären, dass sie die Wahrheit sagen, wenn ihr Erleben nicht in einen stereotyp vermuteten Diskriminierungskontext passt.
Frauen wird, wenn sie von eigenen Erfahrungen und Anschauungen berichten, reflexartig unterstellt, dass sie lügen.
Lügen Frauen eigentlich nicht immer?
Deshalb noch einmal Donna J. Haraway:
„Es ist von Gewicht, mit welchen Erzählungen wir andere Erzählungen erzählen. Es ist von Gewicht, welche Knoten Knoten knoten, welche Gedanken Gedanken denken, welche Beschreibungen Beschreibungen beschreiben, welche Verbindungen Verbindungen verbinden.“
Die Marginalisierung, Beherrschung und Unterwerfung der Frauen ist der Kern patriarchaler Erzählungen von und über Weiblichkeit. Diese Erzählungen knüpfen toxische Knoten, die auch darauf zielen, Verbindungen zwischen Frauen zu verunmöglichen bzw. zu zerstören.
Franziska Schutzbach schreibt in ihrem unbedingt lesenswerten Buch
„Die Erschöpfung der Frauen – Wider die weibliche Verfügbarkeit“:
„Die „Unterwerfung unter das männliche Urteil“ (Elfriede Jellinek) ist nicht nur kränkend, sie macht Frauen zu Gegnerinnen, und das höhlt ihre Energie aus … . Die Schwierigkeit, sich in einer männerzentrierten Gesellschaft positiv an anderen Frauen zu orientieren …, wirkt sich auf den Selbstwert von Frauen aus. Wenn Frauen sich mit Männern identifizieren und an deren Urteil orientieren, geht dies auf Kosten von Frauenbeziehungen. Mit der Folge, dass Frauen sich ihren Selbstwert oft an männlichen Maßstäben erarbeiten, ein unmögliches und erschöpfendes Unterfangen, … . Frauen versuchen, aus ihren Gefühlen der Minderwertigkeit herauszukommen, indem sie alles richtig machen und sich am Urteil der Männer orientieren. Das führt dazu, dass der Blick der Frauen auf andere Frauen und auf sich selbst … negativ ausfällt… .“
Schutzbach zitiert die US-amerikanische Autorin Adrienne Rich, welche in „Of Women Born“ der Frage nachgeht, wie sich die gesellschaftliche Orientierung an Männern auf Frauenbeziehungen auswirkt.
Rich führt aus, dass die Schwächung der Frauen-Bindung ein zentrales Element patriarchaler Macht ist. Frauen, so Rich, müssen „das Weibliche, die Mutter ablehnen, wenn sie als Subjekt wahrgenommen werden wollen, sie müssen sich abwenden von Frauengenealogien und sich dem Männlichen zuwenden – und auf dessen Gunst hoffen“.
Eine der abendländischen Urerzählungen der Bewertungshoheit der Männer über Frauen ist „Das Urteil des Paris“ der griechischen Mythologie. Die unterschiedlichen Epochen der Kunstgeschichte griffen das Thema regelmäßig auf. Auf den jeweiligen Gemälden sind drei mehr oder weniger nackte Frauen zu sehen, die vor dem kritischen Blick eines Mannes posieren, um von ihm einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „Der Schönsten“ zu erhalten. Jede versucht zu gewinnen, indem sie den Mann besticht.
Die drei nackten Frauen sind unsterbliche Göttinnen. Der Mann ist ein etwas beschränkter Sterblicher, wenngleich königlicher Herkunft. Er lässt sich weder durch das Versprechen von Macht (Hera) noch durch das von kriegerischem Ruhm (Pallas Athene) bestechen, sondern spricht den Preis Aphrodite zu, die ihm die schönste Frau der Welt zur Gattin bietet. Der kleine Haken an diesem Deal: Die schönste Frau der Welt hat bereits einen Ehemann.
Die Quintessenz der komplexen Erzählung: Im Kampf um die Gunst eines Mannes tun Frauen nicht nur alles, um einander auszustechen, sie vergessen auch ihre eigene Göttlichkeit. Die Folgen sind verheerend. Der Streit führt zum Untergang eines Reiches und zum Tod vieler Helden (sowie vieler Frauen und Kinder, das sind jedoch Kollateralschäden, die nicht weiter ins Gewicht fallen).
Wie im Christentum ist die Schuldfrage auch in der griechischen Mythologie endgültig geklärt: Es war die Frau.
Eine weitere zentrale Erzählung von Frauenkonkurrenz ist die Geschichte der bösen (Stief)Mutter als Konkurrentin der eigenen Tochter. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land.
Es ist von Gewicht, welche Geschichten Welten machen und welche Welten Geschichten machen.
Dass Frauen mitunter hart bis exzessiv gewaltsam zu anderen Frauen einschließlich ihrer eigenen Töchter sind, liegt nicht in der Natur der Frau oder der Natur des Weiblichen.
Frauen reproduzieren die von ihnen erlittene strukturelle Gewalt in einer Weise, wie Menschen schlechthin ihre Erfahrungen physischer und psychischer Gewalt reproduzieren, solange sie sich nicht ihrer Heilungsaufgabe zuwenden und die ersten Schritte eines Bewusstwerdungsprozesses gehen, die sie aus der Käfighaltung heraus führen.
Und natürlich bedeutet die Tatsache, ein weiblich gelesener Mensch zu sein, nicht zwangsläufig, ein guter Mensch zu sein.
Die taz veranstaltete am vergangenen Internationalen Frauentag einen Talk zum Thema: Reden wir übers Matriarchat. Brauchen wir die Frauenherrschaft? Wie würde diese aussehen?
Maren Kroymann und Mithu Sanyal im von Kathrin Gottschalk moderierten Gespräch. Es ist ein Vergnügen, diesen klugen, schlagfertigen, lustigen Frauen zuzuhören. Du kannst den Talk auf Youtube nachhören.
Die Frage nach der Frauenherrschaft wird erfrischend schnell abgehandelt. Wir wollen nicht die Umkehr der Machtverhältnisse. Wir wollen eine neue Form. Sanyal betont mehrmals, wie wichtig die Entmilitarisierung der Gesellschaft für wirklich tiefgreifende Veränderungen jenseits der Ausübung struktureller Gewalt ist.
Ach, denke ich entzückt. Darüber habe ich doch vor einem Monat geschrieben. Ich nenne es die Logik des Krieges, die unser Denken und Handeln bis in den letzten Winkel einfärbt.
Das ist genau das, was die Frauenbewegung uns lehrt, abgesehen von den vielen praktischen Früchten, die sie, angefangen mit dem Wahlrecht für Frauen, uns geschenkt hat: Die erlittene Gewalt zu reproduzieren ist keine Lösung.
Wir sind auf der Suche nach neuen Formen.
Lasst uns wild und kühn das Neue träumen.
Und nie mit dem Träumen aufhören.
Ich bin Dr. Eva Scheller, Founder #InnerEducationAcademy, Traumatherapeutin, Mentorin in Lern- und Veränderungsprozess, Autorin, Juristin, Aktivistin.
Alten Kontext dekonstruieren.
Inneres Wissen fördern.
Veränderungen wagen.
Neues finden.
Dieser Essay erschien erstmals in den NeuraumpalastNew 3.2025. Die NeuraumpalastNews sind der monatliche Newsletter der Inner Education Academy.